
Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands ziehen an einem Strang: Klage gegen Temu. © HV
Österreich zieht die Zügel für Fernost-Marktplätze an: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums beim Handelsgericht Wien eine Verbandsklage gegen Temu eingebracht. Ziel ist es, manipulative Designmuster („Dark Patterns“) zu unterbinden und Verstöße gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie den EU-Digital Services Act (DSA) zu ahnden. Der Handelsverband begrüßt den Schritt als „dringend erforderliches Signal“, dass große Plattformen nicht über dem Gesetz stehen.
Worum es juristisch geht
Kern der Klage sind Interface-Mechaniken, die Kund:innen zu unbedachten Käufen oder weitreichenden Datenfreigaben verleiten sollen: Glücksräder, Gewinnspiele, Highscore-Tabellen, permanente Pop-ups, künstlicher Zeitdruck und angebliche Knappheiten. Auch „Rabatte“, die sich im Kleingedruckten relativieren, sowie aufwendige Wege zur Kontolöschung (sieben Schritte, eine Woche Wartefrist) werden beanstandet. Als Rechtsgrundlage dienen UWG und DSA. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig bringt die Stoßrichtung pointiert auf den Punkt: „Wer trickst, verliert – auch internationale Onlineramschläden müssen sich an europäische Spielregeln halten.“
Marktmacht und Vollzugslücke
Temu ist binnen kurzer Zeit zum viertgrößten eCommerce-Marktplatz Österreichs aufgestiegen und das mit einem gemeldeten Bruttowarenwert von über 340 Mio. € und nach eigenen Angaben 1,8 Mio. Nutzern hierzulande. Der Handelsverband verweist seit 2024 auf systematische UWG-Probleme (Schein-Knappheiten, irreführende Preisdarstellungen, künstliche Verfügbarkeiten) und kritisiert vor allem den mangelhaften Vollzug vorhandener EU-Regeln gegenüber sogenannten Very Large Online Platforms. Ökonom Michael Böheim (WIFO) dämpft Erwartungen an rein zivilrechtliche Schritte und sieht den „großen Hebel“ bei strengeren Import-Kontrollen: Plattformen müssten für korrekte Deklaration, Einfuhrumsatzsteuer und Zölle haften.

Relevanz für den Schmuck- und Uhrenhandel
Für den Schmuck- und Uhrenhandel ist die VKI-Klage weit mehr als eine Randnotiz, denn sie trifft das Wettbewerbsumfeld direkt. Plattformen, die mit aggressiven „Rabatt-Erlebnissen“ arbeiten, drücken die Zahlungsbereitschaft – selbst in hochwertigen Kategorien. Umso wichtiger werden klare, nachvollziehbare Preisargumente: Materialqualität, Fertigungstiefe, Service und Garantien. Gleichzeitig lässt sich ein Compliance-Vorsprung ausspielen: Transparente Herkunft, zertifizierte Materialien sowie rechtskonforme Widerrufs- und Gewährleistungsprozesse werden zu echten Differenzierungsmerkmalen, wenn Dark Patterns und Deklarationsmängel stärker sanktioniert werden. Hinzu kommt der After-Sales-Aspekt: Billigimporte externalisieren oft Retouren- und Servicekosten; der Fachhandel punktet mit sofortiger Reparatur– und Anpassungsleistung, einem echten Ansprechpartner und planbaren Lieferzeiten, besonders im umsatzstarken Schlussquartal. Kommunikativ eröffnet der politische Gegenwind gegen Plattformtricks die Chance, „ehrliche Preise“ und Qualität neu zu verankern: Aufklärung über Material, Fertigung und Markenservice zahlt sich aus. Und sollte sich eine Plattformhaftung als „deemed importer“ durchsetzen, gleichen sich Teile der Wettbewerbskosten an. Das ist ein Vorteil für jene Juweliere, die heute bereits sauber steuer- und zollkonform arbeiten.
Wie es weitergeht
Der VKI-Schritt ist Teil einer breiteren „Aktion Extrascharf“: Wettbewerbs- und Konsumentenschutzbehörden in der EU erhöhen den Druck auf Dark Patterns, irreführende Rabatte und Daten-Opt-ins. Der Handelsverband sieht erste Verhaltensanpassungen, erwartet aber weitere Verfahren. Unabhängig vom juristischen Ausgang bleibt für Juweliere und Uhrenfachhändler entscheidend, das eigene Profil gegenüber Plattform-Mechaniken zu schärfen: konsequente Transparenz, servicestarke Kundenerlebnisse und belastbare Markenstories – genau dort, wo Dark Patterns nicht greifen können.

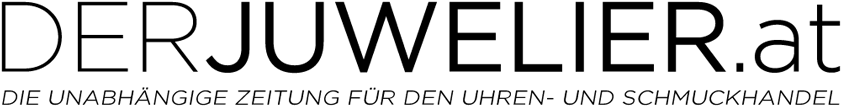
















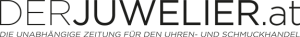
Keine Kommentare